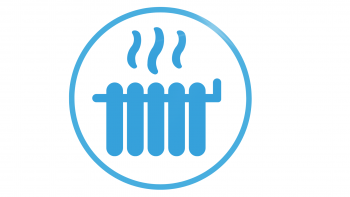Sie suchen Rat zu Fragen rund um Ihre Immobilie? Wir sind für Sie da – ganz in Ihrer Nähe. Wir setzen uns engagiert, kompetent und individuell für das private Eigentum unserer Mitglieder ein.
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG)
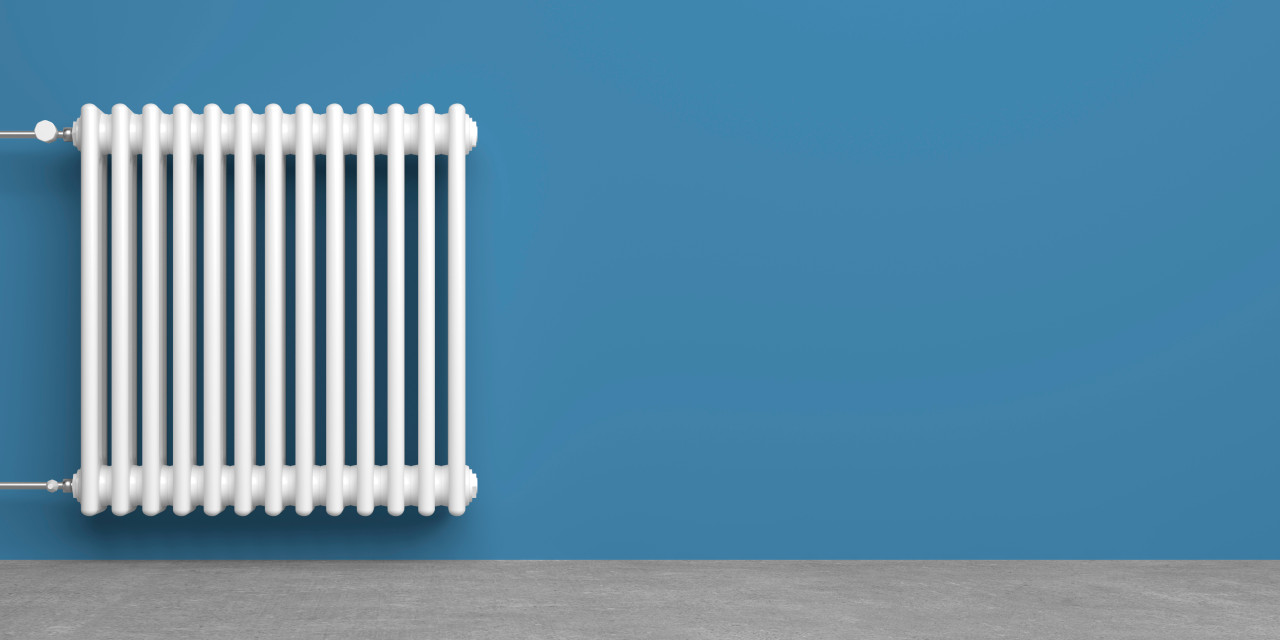
Im vergangenen Jahr hat das Gebäudeenergiegesetz (GEG), auch Heizungsgesetz genannt, für viel Aufsehen gesorgt. Seit dem ersten Gesetzentwurf Ende Februar 2023 bis zum Beschluss im Bundestag am 08.09.2023 ist jedoch viel passiert. Das GEG soll nun praktikabler und für die Eigentümer leichter umzusetzen sein.
Auf dieser Seite finden Sie die wichtigsten Informationen zum neuen Gesetz, das am 1. Januar 2024 in Kraft getreten ist, in Kürze zusammengefasst.
Was bedeutet das GEG für Sie?

Müssen Sie Ihre Heizung austauschen, auch wenn diese noch funktioniert?
Nein, es müssen keine funktionierenden Heizungen außer Betrieb genommen werden. Die Austauschpflicht gilt unverändert nur für 30 Jahre alte Standardheizkessel.
Welche Heizung können Sie einbauen?
Auch nach dem 01.01.2024 können alle Heizungsarten eingebaut werden, solange keine kommunale Wärmeplanung vorliegt. Das gilt auch für Ölheizungen und über das Jahr 2026 hinaus. In Neubaugebieten besteht ab dem 01.01.2024 die Pflicht, 65 Prozent erneuerbare Energie einzusetzen. Dabei darf entgegen den ursprünglichen Plänen auch Biomasse zur Einhaltung der 65-Prozent-Anforderung bei der Heizung genutzt werden.
Was muss nun in Sachen Wärmeplanung passieren?
Die Erstellung von Wärmeplänen durch die Kommunen wird verpflichtend und gilt flächendeckend, auch in Gebieten und Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern.
Die Wärmepläne müssen deutschlandweit bis spätestens 30.06.2028 erstellt werden, wobei es gestaffelte Fristen für verschiedene Gebietsgrößen gibt.
Was müssen Sie tun, wenn eine kommunale Wärmeplanung für Ihren Wohnort vorliegt?
Wenn eine kommunale Wärmeplanung vorliegt, müssen Eigentümerinnen und Eigentümer die Pflicht zur Nutzung von 65 Prozent erneuerbarer Energie bei Einbau einer neuen Heizung erfüllen.
Eine Ausnahme davon gilt nach den jetzigen Plänen zum Gesetz für alle Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer, bei denen ein sozialer Härtefall vorliegt.
Neben einer Wärmepumpe, kann auch eine mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen betriebene Brennwertheizung eingebaut werden. Diese muss gestaffelt mit einem höheren Anteil von Biomasse oder Wasserstoff einschließlich deren Derivate betrieben werden: nach 2029 mindestens 15 Prozent, nach 2035 mindestens 30 Prozent und nach 2040 mindestens 60 Prozent.

Förderung
Wie und was wird gefördert?
Es wird voraussichtlich ab 01.01.2024 eine Grundförderung von 30 Prozent der Investitionskosten für neue Heizungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden geben – für alle Eigentümer.
Selbstnutzende Wohneigentümer mit einem zu versteuernden Haushaltseinkommen von bis zu 40.000 Euro pro Jahr erhalten zusätzlich einen Förderbonus von 30 Prozent.
Es gibt zudem ein Klima-Geschwindigkeitsbonus von 20 Prozent bis 2028, der danach alle zwei Jahre um 3 Prozentpunkte abnimmt. Der Klima-Geschwindigkeitsbonus wird allen selbstnutzenden Wohneigentümern gewährt, deren Gasheizung zum Zeitpunkt der Antragsstellung mindestens 20 Jahre alt ist, oder die eine Öl-, Kohle-, Gasetagen- oder Nachtspeicherheizung besitzen.
Die Förderung kann zusammengerechnet werden, jedoch nur bis zu einem Höchst-Fördersatz von 70 Prozent. Die maximal förderfähigen Investitionskosten liegen bei 30.000 Euro für ein Einfamilienhaus.
Bei Mehrparteienhäusern liegen die maximal förderfähigen Kosten bei 30.000 Euro für die erste Wohneinheit, für die zweite bis sechste Wohneinheit bei je 10.000 Euro, ab der siebten Wohneinheit bei je 3.000 Euro.
Die bestehende Förderung für Gebäude-Effizienzmaßnahmen bleibt erhalten.
Es werden zinsvergünstigte Kredite mit langen Laufzeiten und Tilgungszuschüssen für den Heizungstausch oder Effizienzmaßnahmen angeboten. Diese stehen Haushalten mit einem zu versteuernden Einkommen von bis zu 90.000 Euro zur Verfügung, um auch Personen zu unterstützen, die aufgrund von Alter oder Einkommen keine regulären Kredite erhalten würden. Der Bund übernimmt das Ausfallrisiko dieser Kredite.

Sie sind Vermieter?
Was bedeutet das Gebäudeenergiegesetz für Vermieter?
Das Aufstellen oder der Einbau einer neuen Heizungsanlage, die die Voraussetzungen des geänderten Gebäudeenergiegesetzes erfüllt, wird als eine neue Modernisierungsmaßnahme betrachtet. Es gibt auch eine weitere Modernisierungsmieterhöhungsmöglichkeit. Der Vermieter hat die Wahl, ob und von welcher Mieterhöhungsvariante er Gebrauch machen möchte.
1.Variante: Mieterhöhung nach bekanntem Modell
Die Mieterhöhung erfolgt auf der Grundlage der aufgewendeten Modernisierungskosten.
Um diese zu ermitteln, müssen die für die Instandhaltung aufgewendeten Kosten von den Gesamtkosten pro Wohnung abgezogen werden. Bei der modernisierenden Erneuerung ist auch der Verschleißgrad der ersetzten Bauteile zu berücksichtigen.
Von den für die Wohnung aufgewendeten Modernisierungskosten können 8 Prozent auf die jährliche Miete umgelegt werden aber niemals mehr als 50 Cent pro Quadratmeter im Monat. Von der 50-Cent-Grenze sind jedoch Maßnahmen nicht erfasst, die im Zusammenhang mit dem Einbau der Heizungsanlage stehen, die etwa die Verteilung oder Speicherung der Wärme betreffen. Solche Maßnahmen können gleichzeitig ausgeführt werden und berechtigen ebenfalls zu Modernisierungsmieterhöhung. Insgesamt darf die Mieterhöhung innerhalb von sechs Jahren mehr als 3 Euro pro Quadratmeter im Monat betragen. Bei einer Quadratmetermiete bis zu 7 Euro im Monat beträgt die Kappungsgrenze insgesamt nur 2 Euro.
2. Variante: Mieterhöhung in Kombination mit Förderung
Hat der Vermieter eine Heizungsanlage gemäß den gesetzlichen Vorgaben eingebaut und dafür öffentliche Zuschüsse erhalten, kann er zukünftig die jährliche Miete um 10 Prozent der Gesamtkosten für die Wohnung erhöhen. Dabei werden die Modernisierungs- und Instandhaltungskosten berücksichtigt, wobei ein pauschaler Instandhaltungsabzug von 15 Prozent erfolgt. Die monatliche Miete darf jedoch nicht um mehr als 50 Cent pro Quadratmeter erhöht werden.
Härtefälle
Will der Vermieter eine Modernisierungsmieterhöhung durchführen, kann sich der Mieter auf eine unbillige Härte berufen.
Indexmietverträge
Bei Mietverträgen, die an den Verbraucherpreisindex gekoppelt sind (Indexmietverträge), sind Modernisierungsmieterhöhungen ausgeschlossen. Dies gilt auch dann, wenn der Einbau einer neuen Heizungsanlage gesetzlich vorgeschrieben ist.
Was gilt für den Einbau von Wärmepumpen?
Wenn ein Vermieter eine Wärmepumpe einbauen möchte, muss er nachweisen, dass diese eine bestimmte Effizienz hat. Die Effizienz wird durch die Jahresarbeitszahl gemessen. Diese muss mindestens 2,5 betragen. Wenn dieser Nachweis nicht erbracht werden kann, darf der Vermieter den Mietpreis zwar erhöhen, aber nur 50 Prozent der Kosten für den Einbau der Wärmepumpe dürfen dabei berücksichtigt werden.
Bei der neuen Variante Mieterhöhung in Kombination mit Förderung dürfen nur 50 Prozent der Kosten für die Wohnung, die für die Modernisierung und Instandhaltung anrechenbar sind (also Modernisierungs- und Instandhaltungskosten abzüglich 15 Prozent), als Grundlage für die monatliche Mieterhöhung verwendet werden.
Es gibt jedoch Ausnahmen für Neubauten (die nach 1996 gebaut wurden) und modernisierte Gebäude (die den Effizienzhausstandart 115 oder 110 erfüllen). In diesen Fällen ist kein Nachweis erforderlich. Der Nachweis muss von einem Fachunternehmer erbracht werden, vor der Inbetriebnahme der Anlage und nicht anhand von Betriebsdaten.
Was ändert sich im Bereich Heiz- und Betriebskosten?
Die üblichen Kosten für den Betrieb der Heizungsanlage können auf die Mieter weiterhin im gewohnten Umfang als Betriebskosten umgelegt werden. Auch hier müssen CO2-Kosten nach dem CO2-Kostenaufteilungsgesetz zwischen Vermieter und Mieter verteilt werden, sofern CO2-Kosten anfallen.
Beim Einbau von Wärmepumpen muss künftig der Verbrauch erfasst werden. Eigentümer haben bis zum 30. September 2025 Zeit, um Verbrauchserfassungsgeräte erstmalig einzubauen. Danach gelten die Abrechnungsvorschriften der Heizkostenverordnung.
Wenn ein Warmmietenmodell auf die Verbrauchsabrechnung umgestellt wird, muss der Vermieter den Durchschnittswert der jährlichen Kosten für Wärme und Warmwasser in den Jahren 2022, 2023 und 2024 ermitteln und den Anteil der einzelnen Wohneinheiten entsprechend ihrer Wohn- und Nutzfläche berechnen.
In der Betriebskostenverordnung werden nun auch die zur Wärmeerzeugung verbrauchten Stromkosten aufgenommen.